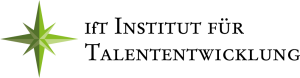Projektwoche Erinnerungskultur
In unserer jährlichen Projektwoche befassen sich die Schüler mit der Frage, ob die Erinnerung an die NS-Zeit für Jugendliche heute noch zeitgemäß ist. Dazu besuchen sie verschiedene Gedenkstätten in und um Berlin. Vor Ort setzen sie sich kritisch mit der Geschichte und der Bedeutung des Gedenkens auseinander. Die Ergebnisse ihrer Arbeit halten die Jugendlichen in einem Medium ihrer Wahl fest, z. B. als Podcast, Video oder Präsentation. Ziel ist es, ein Bewusstsein für die historische Verantwortung zu schaffen und neue Zugänge zur Erinnerungskultur zu finden.
Besuchsorte (Auswahl)
Gedenkstätte Stille Helden (Stiftung Gedenkstätte Deutscher Widerstand): https://www.gedenkstaette-stille-helden.de/bildungsangebote
Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen (Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten): https://www.sachsenhausen-sbg.de/bildungsangebote/
Dokumentationszentrum Topographie des Terrors (Stiftung Topographie des Terrors): https://www.topographie.de/bildungsangebote/
Exkursion Hohenschönhausen
Die Grund- und Leistungskurse besuchen jährlich die Gedenkstätte Hohenschönhausen, um sich intensiv mit der Geschichte der ehemaligen Stasi-Haftanstalt auseinanderzusetzen. Dieser Besuch ist von großer Bedeutung, da er den Schülerinnen und Schülern ein tieferes Verständnis für die Mechanismen von Unrecht und staatlicher Willkür vermittelt und zur Bewahrung der Demokratie mahnt.
Gedenkstätte Hohenschönhausen (Stiftung Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen): https://www.stiftung-hsh.de/themen
Veranstaltung Zeitzeuginnengespräch
Die Geschichtslehrkräfte bemühen sich, regelmäßig Zeitzeuginnen in den Unterricht einzubinden, um den Schülerinnen und Schülern lebendige Einblicke in historische Ereignisse zu ermöglichen. Durch diese persönlichen Begegnungen wird das Verständnis für die Vergangenheit vertieft und die Bedeutung des Geschichtsunterrichts hervorgehoben.
Bericht von Mathilda (2024)
Projektbericht Jahrgang 9:
Erinnerungskultur an die NS-Zeit – Für Jugendliche heute noch zeitgemäß?
Kurz vor den Sommerferien fand für den gesamten 9. Jahrgang das Geschichtsprojekt zur Erinnerungskultur an die NS-Zeit statt. Mit verschiedenen Ausflügen und Veranstaltungen erlebten wir eine abwechslungsreiche, interessante und lehrreiche Woche. Ziel war es, dass jede Gruppe am Ende des Projekts einen Podcast als Endprodukt erstellt.
Am ersten Tag des Projekts erhielten wir eine Einführung, und anschließend hatten wir die Ehre, ein Zeitzeugengespräch mit dem 92-jährigen Jürgen Kirschning zu führen. Dabei konnten wir neue Ansichten aus der NS-Zeit kennenlernen und offene Fragen klären. Seine Ausführungen haben uns tief beeindruckt, und es war ein ganz besonderes Erlebnis, einem Zeitzeugen zu begegnen.
Der erste Ausflug führte uns in die Gedenkstätte und das Museum Sachsenhausen. Im Rahmen einer Führung erhielten wir einen umfassenden Überblick über die Gedenkstätte und entdeckten viele detaillierte Informationen. Dies schärfte bei vielen von uns das Bewusstsein für die Wichtigkeit von Erinnerung und Aufklärung. Die verschiedenen Eindrücke haben uns stark bewegt. An diesem Ort mit seiner tragischen Geschichte gewesen zu sein, wird uns lange in Erinnerung bleiben.
Den nächsten Studientag verbrachten wir in der Gedenkstätte „Stille Helden“ und am Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Durch verschiedene Aufgaben vertieften wir unser Wissen über den Holocaust. In einem Workshop an der Gedenkstätte erfuhren wir noch mehr über diesen historischen Ort und seine Bedeutung.
Am letzten Tag des Projekts erstellten wir in den einzelnen Gruppen jeweils einen Podcast zu zwei der drei Exkursionsorte. Am Ende des Tages hörten wir uns die Podcasts gemeinsam an und werteten das Projekt aus.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Woche sehr interessant und erlebnisreich war. Wir haben viel Neues gelernt und durch praktische Erfahrungen unser Wissen vertieft.
Ausstellung Was konnten sie tun?
1933 übernahmen Hitler und die Nationalsozialisten die Macht in Deutschland und errichteten eine Diktatur. Die meisten Deutschen unterstützten das Regime begeistert oder passten sich an, da sie sich Vorteile davon versprachen. Nur wenige Menschen wagten es jedoch, Widerstand gegen die Menschenrechtsverletzungen und Verbrechen der neuen Machthaber zu leisten. Mit dem deutschen Überfall auf Polen 1939 begann der Zweite Weltkrieg, und das Regime verschärfte die Verfolgung seiner Gegner. Die Ausstellung zeigt, wie unterschiedlich der Widerstand gegen die Nationalsozialisten war, von der Verbreitung kritischer Informationen über Hilfe für Verfolgte bis hin zu Attentatsversuchen auf Hitler.
Was konnten sie tun? Widerstand gegen den Nationalsozialismus 1939-1945 (Gedenkstätte Deutscher Widerstand): https://www.was-konnten-sie-tun.de/